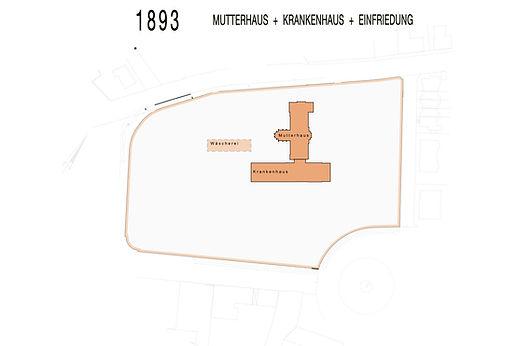top of page

Start
In der heutigen Architektur gilt nach wie vor die Vergangenheit als Inspiration in den Entwurfsprozess miteinzubeziehen und auf bereits bewährte Stilmittel zurückzugreifen, um ein vielfältiges Stadtbild zu erreichen. Die Gratwanderung zwischen dem Wunsch nach Bewahrung und der Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Nutzung dieser historischen Gebäuden führt immer wieder zu Diskussionen. Die Chancen für diese einmaligen historischen Bauwerke erhöht sich jedoch, wenn die Bevölkerung diese Bauten schätzen gelernt hat.
Kontext
Bauherr
Baugeschichte
Das Erbe
Kapelle
weitere Gebäude
... tauchen Sie ein in die Welt von Jean Keller,
Architekt des Historismus in Augsburg !
bottom of page

.png)